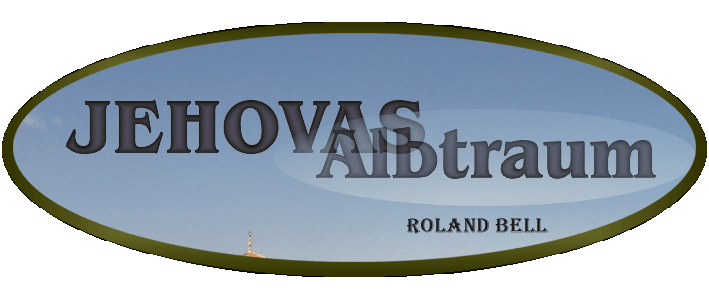
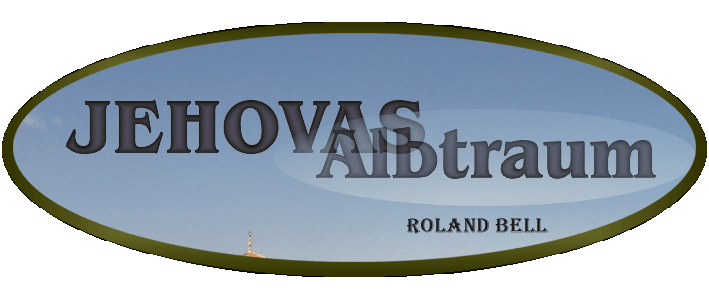
Zum Abendessen kamen die Panzer.
In einem Straßengraben beehrte ich zusammen mit meiner abgewetzten Barbie einen Mogwai aus Plüsch in seinem Herrschaftshaus. Die Vorhut der jüdischen Armee verständigte sich durch Kommandos auf Arabisch; ihre Worte drangen nicht in meine Welt. Mit meinen Spielgefährten tänzelte ich über den Ballsaal des Palastes von Königin Scheherazade. Den olivgrünen Schatten des israelischen Gefreiten übersah ich - und auf wundersame Weise blieb meine kauernde Gestalt auch ihm verborgen. Bis das Rasseln von Ketten und das Dröhnen der Motoren meinen Palast verschlang und die Welt zurückfiel in das Ocker des Sandsteins.
Als meine Nase aus dem Graben hervorlugte, sah ich mich umgeben von Panzern. Angst fühlte ich keine. Wie will sich ein fünfjähriges Mädchen bedroht fühlen von solcherlei Ungetümen? So wenig, wie die Eintagsfliege einen Menschen zu fürchten vermag. Nein, ausgeliefert fühlte ich mich einer Welt aus Stahl, Öl und Qualm. Ein Rekrut schnellte von seinem Merkava Mark II und stapfte auf mich zu. Hebräische Flüche brüllte er in die Dämmerung und lächelte auf mich herab. Sein M16-Sturmgewehr ruhte mit gesenktem Lauf in der Rechten, entsichert, wie mein geübter Blick feststellte. Seine Linke griff nach mir. Tief in den Staub duckte ich mich, meine synthetischen Spielgefährten fest umklammert. Der Rauch seiner Zigarette senkte sich über mich. Ich kniff die Augen zusammen und schrie meine Verlorenheit hinaus. Mein Kreischen erhöhte sich um eine Oktave, als zwei behaarte Pranken mich nach oben zogen. Der vertraute Geruch von Oliven und Kardamom drang mir in die Nase und erleichtert sank ich in die Arme meines Vaters, der mir über den Nacken streichelte und mich mit einem Singsang beruhigte. Auf der Suche nach mir hatte er sich den Panzern mit erhobenen Händen und freiem Oberkörper entgegengeworfen und mit seinem gebrochenen Hebräisch "Friede, Brüder! Meine Tochter Nasim spielt hier im Sand!" geschrien.
Zitternd drückte ich mein Gesicht in seine Brust, die so wohlig nach Sorge und Erleichterung roch. Panzer, Motorräder und Bulldozer hörte ich an uns vorbeifahren. Zornig schrie uns die Nachhut hinterher, wir mögen verschwinden; die Lebensgefahr jedoch war gebannt.
Gerade wollte ich mich bei Vater für meinen Leichtsinn entschuldigen, da spürte ich durch die Haut seinen Herzschlag beschleunigen und er spurtete los: "Sie ziehen in unser Viertel!" Hinter einer Ecke hatte sie gelauert, die Furcht, um uns jetzt erneut anzufallen. Vater rannte und ich betete, er möge mich nicht absetzen. Durch die Gassen Ramallahs holten wir die Juden, die sich die Hauptstraße entlangquälen mussten, rasch ein. Die Nachbarn kamen uns entgegengerannt, manche mit weinerlichen, manche mit blitzenden Augen. Frierend drängten sie sich aneinander, einige Frauen hatte ich noch nie außerhalb des Hauses ohne Kopftuch gesehen. Wie ein Schild hielt mein Vater mich den brüllenden und drohenden Soldaten entgegen. Seine Lebensversicherung war ich, deshalb zeigte ich den Besatzern mein Gesicht. Doch bald half das nichts mehr.
"Stopp!" Auf der ganzen Welt versteht man dieses Wort. Drohend schwenkte der Jude seine MAK. Vater trat beschwichtigend einen Schritt vor - nur einen. Hase und Stier rangen in ihm, als der Bulldozer unser Haus verschlang. Nichts hatten die Sandsteinwände dem Stahlkoloss entgegenzusetzen. Die Häuser unserer Nachbarn stürzten als Nächstes. Hilflos zerbarst die Wut eines palästinensischen Viertels an den Panzern der Besatzer.
"Ihr reißt unser Zuhause nieder!" Verzweiflung bemächtigte sich Vaters Stimme. Einen weiteren Schritt trat er vor und wieder hielt das MG ihn zurück, bequemte sich aber einer Antwort: "Für die Gebäude liegt keine Baugenehmigung vor, abgerissen müssen sie werden."
"Kaum einem Palästinenser habt ihr in den letzten zwanzig Jahren eine Baugenehmigung erteilt!", brüllte mein Vater. "Nur die lausigen jüdischen Siedler dürfen bauen."
"Das Land von Judäa und Samaria ist genauso unser Land wie das eure", hielt der Jude entgegen. Doch fehlte seinen Worten die Kraft. Kaum zwanzig war er, braun gebrannt, vermutlich aus Tel Aviv, leistete er in einem fremden Land, dem von Israel besetzten Westjordanland, seinen Wehrdienst ab. Und tausendmal lieber wäre er über die Wellen des Mittelmeers gesurft, als mit Helm und Sturmgewehr die Bulldozer vor Frauen und Kindern zu beschützen.
"Das von eurem Gott versprochenes Land beherbergt mehr israelische Soldaten als jüdische Siedler!" Die Stimme meines Vaters sank hinab wie sein Blick. Wie denn mit einem Bulldozer diskutieren? Zu spät, zu Schutt und Staub war unser Haus zermalmt. Die Herzlosigkeit triumphierte.
"Nasim!" Meine Mutter löste sich aus der erstarrten Menschenmenge und rannte auf uns zu, gefolgt von meinen beiden Brüdern. Wie alle Anwohner hatte man sie aus den Häusern getrieben, kein Blut wollten die Soldaten heute sehen. Aufatmend umarmten wir uns.
Später stieß mein Onkel mit seiner Frau zu uns; Hiobsbotschaften verbreiteten sich im Viertel schneller als Panzer. Wir weinten gemeinsam, wir fluchten gemeinsam und machten uns auf dem Weg zu seinem Haus. Genauso unrechtmäßig hatte er es errichtet wie viele andere im Viertel. Beengt war es. Aber der Ölofen spendete Wärme, wir aßen Gemüseeintopf, Joghurt mit Nüssen und Datteln, während die Soldaten ihre Nachtschicht beendeten. Beide Seiten beteten denselben Gott an, mit unterschiedlichem Namen. Obdachlos würden wir morgen die Trümmer nach Resten unseres Lebens durchwühlen.
Doch heute Abend lagen wir alle fünf eng umschlungen im Wohnzimmer meines Onkels. Meine Brüder schnarchten, ihr Atem roch nach Knoblauch und Kardamom, ich lagwach zwischen meinen Eltern, zu aufgeregt, um einzuschlafen. Mutter trug das mandelfarbene mit feinem Garn bestickte Tuch um die Schultern, das sie so liebte. Mehr hatte sie nicht retten können. Ihr staubiges Haar, in das ich mich hineinkuschelte, duftete nach einem Hauch von Vanille. Mein Vater schaffte es, uns beide im Arm zu halten. Besitzergreifend ruhte seine Hand am Busen meiner Mutter, wohlig im Halbschlaf grunzend. Ich schmiegte mich an ihn und war - glücklich. Ewig würde mich dieser Arm beschützen - gegen Winde, Sandstürme und jüdische Panzer. Selbst gegen Schaitan persönlich. Die Heimat in unseren Herzen, erklärte Vater später, könne niemand niederreißen. Wie wahr. Wenn ich mich einsam fühle, sehne ich mich zurück nach Ramallah in die Arme meines Vaters.
Mag es ein Tag der Heimsuchung für meine Brüder gewesen sein - der Jüngste wurde wieder Bettnässer und blieb es bis zum zwölften Lebensjahr - so fühlte ich mich behütet und geliebt wie niemals wieder. Der Tag, an dem uns die Panzer heimsuchten, wurde zum glücklichsten Tag meines Lebens.
"Von der Herzlosigkeit, die triumphierte, sprichst du wie von einem Feind. Zielst du auf die Juden damit?"
"Nein, Professor, auf ihre Panzer. Kalt und tot waren sie. Das seelenlose Gegenstück zur Wärme meines Vaters. Vater ist weg und niemand beschützt mich vor der Kälte, mir bleibt nur die Erinnerung."
"Lediglich mit einer Erinnerung der Kälte des Daseins entgegenzutreten. Schwierig. Begegnet dir das Herzlose noch immer?"
"Wie jedem von uns, Professor. Doch nie wieder bohrte sich die Kälte so tief in mein Herz wie an dem Tag, an dem der Admiral starb."
"Der Admiral? Klingt nach einer ungewöhnlichen Geschichte, Nasim."
"Zugehört, bei Gott!", bellt die Stimme des Admirals durch die Katakomben. Ich nehme die Hand von der Maus und schaue vom Bildschirm auf. Mitten im Satz unterbrechen die Kämpfer neben mir ihren Disput über den deutschen Trainer von Real Madrid.
"Zeit, meine Nachfolge zu ordnen." Das Schweigen wird ohrenbetäubend, Unglaube gesellt sich hinzu.
"Bring Abu Ismael zu mir!" Eifrig stolpert ein vierzehnjähriger Junge nach draußen. Der Admiral verteilt bereits die nächsten Befehle: "Hört zu! Unwichtig, ob ich ihm meine Autorität persönlich übergebe: Abu Ismael bestimme ich zu meinem Nachfolger, mit Gott als Zeugen. Alle notablen Familien vertrauen ihm, kampferprobt ist er, diplomatisches Geschick besitzt er, genau wie euren Respekt. Wie ich bis heute, so wird Abu Ismael ab morgen die Truppen des Lagers führen. Vorsehen soll er sich vor den offenen und versteckten Feinden hier. Denn morgen speise ich an Gottes Tafel im Kreise der Gläubigen. Ich wurde vergiftet!"
Vorbei mit der Stille, wild brüllen alle durcheinander, einige greifen zu ihren Gewehren, als wollten sie das Gift niederschießen. Gelähmt kauere ich vor der Tastatur. Mit gequälten Augen läuft der Sohn des Admirals auf seinen Vater zu, ein Wink gebietet ihm Einhalt: "Mir bleibt keine Zeit. Ich wünsche keine Rache! Weder euch Kämpfern noch dir, meinem Sohn, erlaube ich, um meiner Willen zu töten. Steht zusammen, kämpft für Palästina!" Seine Stimme kühlt ab. "Schwöre es, mein Sohn!" Sein unbarmherziger Blick ringt dem Ältesten ein stummes Versprechen ab. Ergeben neigt der Sohn das Haupt vor seinem Vater und Anführer.

Der Admiral zückt sein Telefon und wählt, schreitet zu meinem Pult, legt den Hörer darauf ab und greift nach einem Stück Papier. "Meine Worte erreichen euch und den Sprecher des palästinensischen Rates im Lager. Morgen erwarten wir in al-Bireh eine Waffenlieferung. Abu Ismael wird sie an meiner statt annehmen, dazu legitimiert ihn dieses Schreiben. Nur erfahrene Kämpfer soll er mitnehmen; die jungen Männer spielen an den MGs wie die Kinder an ihren Telefonen." Sein Spott verhallt unbeachtet. "Überliefert dem Richter die mahnenden Worte eines Sterbenden: Die Hygiene im Lager soll er ebenso kleinlich überwachen wie die Zeiten des Gebets."
Kein Wort des Hasses, keine Geste der Verzweiflung entfuhr dem Admiral. Dem Admiral, der nie ein Schiff betreten, geschweige denn eine Flotte befehligt hatte. Als Jugendlicher hatte er sich für den englischen Seehelden Admiral Horatio Nelson begeistert und sich dessen Rang einverleibt, der sich immerhin von einem arabischen Wort ableitet. Die Begeisterung für den europäischen Imperialismus war verflogen, der Spitzname geblieben. Wie wir alle kämpfte er im Flüchtlingslager al-Amari, nördlich von Jerusalem, um die Belange der Palästinenser. Mit der Waffe, mit der Schaufel, mit dem Wort. Im Zuge der Katastrophe, der Gründung Israels 1948, waren seine Eltern, wie siebenhunderttausend weitere Palästinenser, aus dem neuen Staat geflüchtet oder vertrieben worden. In diesem Flüchtlingslager wurde er geboren, hier kämpfte er sein Leben lang - und hier starb er. Starb als inoffizieller Leiter des Lagers, abgesegnet von der Palästinensischen Autonomiebehörde und - viel wichtiger - von den hochrangigen Familien in al-Amari. In den letzten fünfzig Jahren war das Lager längst zur Stadt geworden. Zu einer abgesonderten Stadt. Dass die Vereinten Nationen es nominell leiteten - und leibhaftig finanzierten - für den Admiral eine Randnotiz.
Jetzt regelte er seinen Nachlass: Die UNO-Verwaltung musste benachrichtigt werden. Neue skandinavische Lehrer und Ausbilder würden morgen ankommen, die herumgeführt und eingewiesen werden mussten. Ein Schwarzhändler aus Jordanien brachte wöchentlich Lebensmittel und Medikamente, die zu bezahlen und möglichst gerecht zu verteilen waren. Keine Einzelheit entging ihm. Zuletzt opferte er seinem Sohn einige Sekunden. Endlich. "Kümmere dich um deine Mutter und deine Geschwister. Möge Gott über euch wachen und euch Frieden und Wohlstand schenken." Fast stürzte er, klammerte sich an der Kante meines Schreibtischs fest. Statt Worte fanden wir nur Raunen.
Verkniffen lächelnd beugte sich der Admiral zu mir herab, sein Telefon schaltete er ab. "Einige Briefbogen unterschreibe ich noch. Handle in meinem Sinne, Nasim, wenn du sie ausfüllst. Ich weiß, ich kann dir vertrauen."
Sein Blick bohrte sich durch meine Augäpfel. Eiszapfen, die in meine Seele drangen. Für Giftanschläge war der jüdische Geheimdienst berüchtigt. Doch ohne Hilfe aus dem Lager? Warum befahl der Admiral seinen Männern so vertrauensvoll, wo er einen von ihnen für seinen Mörder halten musste? Wie schob er den Gedanken ans Sterben mit so leichter Hand beiseite? Ich wusste: An Gott hatte er nie geglaubt, rechnete weder mit Strafe noch Belohnung im Jenseits. Für seine Ziele hatte er gelebt, nicht für ein ungewisses Paradies.
Abu Ismael, sein Nachfolger, hatte es nicht rechtzeitig geschafft. Flüchtig umarmte der Todgeweihte seinen Sohn, dann schickte er uns alle hinaus, setzte sich aufrecht in seinen Lederstuhl, legte die Hände in den Schoß und wartete gelassen auf das Ende. Bereits fünf Jahre nach seinem Tod rankten sich Legenden um sein Sterben - genau wie um seine letzten Worte: "Nicht der letzte Palästinenser werde ich sein, der in Unfreiheit sterben muss. Doch irgendwann reißt die Kette."
An die Worte erinnere ich mich nicht, nur an seine grauen Augen, die mich noch heute frösteln lassen. Hatte er je ein Herz besessen, lange vor ihm musste es zu Staub zerfallen sein.